petra paulet al.PORTRAITS AS IMAGES
Unter dem Titel Portraits as Images zeigt das Frauencafé (1080 Wien, Lange Gasse 11) Fotografien und Anagramme von Petra Paul. Einerseits werden eine Reihe von Selbstporträts gezeigt, andererseits Fotos von Freundinnen der Künstlerin. Anagramme aus den Namen der abgebildeten Protagonistinnen machen aus der Sprache visuell-poetische Dekorationen.  Die Frau als Bild
Die zentrale Frage in Petra Pauls Werk ist nicht die nach einer weiblichen Körpersprache, sondern das Problem der Repräsentation des weibliche Körpers im Bild. Elisabeth Voggeneder meint dazu: „Wie schon in ihrer Werkreihe strip – no body for nobody die im Frauencafé im März dieses Jahres zu sehen war, thematisiert die Künstlerin auch mit Ihren Fotografien die Präsentation des weiblichen Selbst im Spannungsfeld von Selbstwahrnehmung und gesellschaftlicher Determination.” Porträts als images können nicht nur als Repräsentation, sondern auch als Vorstellung und Idee von Repräsentierbarkeit an sich gesehen werden. Das image bezieht sich nicht nur auf die Bildhaftigkeit der dargestellten Personen, sondern auch auf die Vorstellung, das (positive) Bild, das ein einzelner oder eine Gruppe von einer Einzelperson oder einer anderen Gruppe hat (Persönlichkeits- oder Charakterbild). Die Schwierigkeit liegt laut Petra Paul darin, eine Person nur abzubilden – nur die äußere Hülle, den Körper einzufangen. Sie versucht mit ihren Fotografien das Wesen der dargestellten Frauen visuell umzusetzten – wofür sie die Frauen gut kennen muss. Images spiegeln Verkörperungen bildlicher Imaginationen wieder, wobei die Bildhaftigkeit der Frau à priori problematisch ist. Diese Problematik des Frauenbildes liegt nicht nur in diskriminierenden und degradierenden Darstellungen (was die Zweite Frauenbewegung aufdeckte), sondern in der Bildhaftigkeit selbst. John Berger kritisiert das traditionelle Bildrepertoire und behauptet, der männliche Blick würde den weiblichen Körper wie einen Gegenstand in Besitz nehmen und das in der Öffentlichkeit verbreitete Bild der Frau diene dazu, den männlichen Betrachter in seiner Macht zu bestätigen, ihm zu schmeicheln. Aber gerade, wenn sich eine Frau explizit als Bildkörper inszeniert und bewusst als künstliche Repräsentation präsentiert, wird dem visuellen Akt der Objektivierung der Frau etwas entzogen, d.h. wenn Frauen das an sie herangetragene Begehren des männlichen Betrachters dadurch befriedigen, dass sie sich vollends in die Chiffre seines Blicks verwandeln, bringen sie die ihnen abverlangte Entstellung immer auch mit zum Ausdruck.  Dagegen wandten sich Frauen, indem sie sich von auf sie projizierte Bilder lossagten. „Stichwort: Selbst-Inszenierung [...] Frauen haben nicht den lockeren, universellen, narzisstischen Blick auf den eigenen Körper. Im Gegenteil: Es gab eine Zeit in der Frauenbewegung, zu Anfang der 80er Jahre z.B., da entdeckten Frauen ihr Dicksein, ihr Hässlichsein und schufen eine neue Selbstverständlichkeit, ein Ja zum eigenen Körper. Sich ungeachtet tradierter, von Männern fixierten Schönheitsnormen zu zeigen, wurde dabei zum Markenzeichen der Frauenbewegung." Der Blick der Frau auf das Selbst hat somit nicht unbedingt etwas mit Narzissmus zu tun. Wir befinden uns aber m.E. in einer narzisstischen Epoche, in der Narziss nicht als Folge einer libidinösen Rückkehr zu sich selber heraufbeschwört wird oder als Wunsch zur Selbstgefälligkeit, sondern als Wille zur Selbsterkundung. Frauen fordern ihren Körper als Ort der Erfahrung und als Bild. Künstlerinnen beschäftigen sich oftmals mit Themen, die grötenteils mit Weiblichkeit in Zusammenhang stehen – wie Mutterschaft, Menstruation, Striptease oder Schönheitsoperationen. Eine Möglichkeit, das traditionelle, männliche Bildrepertoire aufzubrechen, bietet die Inszenierung des Selbst als Maske.  Das Selbst als Maske
Die Frau muss zur Frau werden, während der Mann von Vornherein ein Mann ist. „Er braucht lediglich sein Mann-Sein zu vollziehen, während die Frau gezwungen ist, eine normale Frau zu werden, das heißt in die Maskerade der Weiblichkeit einzutreten." Die Frau ist nicht von Natur aus Frau, sondern sie wird durch die Gesellschaft dazu gemacht. „Tatsächlich ist aber diese ,Weiblichkeit' eine Rolle, ein Bild, ein Wert, der den Frauen durch Repräsentationssysteme der Männer auferlegt wird. In dieser Maskerade verliert sich die Frau, und sie verliert sich darin, gerade weil sie Weiblichkeit spielt." Mit der Metapher „Kultur als Performance" trat eine Begrifflichkeit in den Vordergrund, welche aus dem Theater stammt: Inszenierung, Spiel, Maske, Spektakel. In den Künsten überlagert seit den 60er Jahren der Aufführungscharakter den Artefaktcharakter. In Goffmans Ansatz wird die Gesellschaft als Theater dargestellt. Grundlegende Begriffe dafür sind „Inszenierung" und „Selbstinszenierung". Goffman geht von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes „Person" (lat. „persona" = Maske) aus. „Persona" ist die Maske, welche das Selbstbild darstellt, das Selbst, wie es sich nach außen hin präsentieren möchte. Die Maske dient der Produktion und der Behauptung des Selbst. Diese Selbstdarstellung im Alltag vergleicht Goffman mit einer Theatervorstellung und soziales Handeln sowie das Umfeld der Interaktion werden mit Begriffen wie „Bühne", „Requisiten", „Ensemble" beschrieben. Selbstdarstellung als Dramaturgie bzw. Inszenierung zu interpretieren ermöglicht es, Machtstrukturen in Beziehungen zu analysieren. „Macht jeder Art muss mit wirksamen Mitteln der Zurschaustellung verbunden sein und wird verschiedene Auswirkungen haben, je nachdem, wie sie dramatisiert wird." Um ein Selbst dramaturgisch zu produzieren, sind Mittel notwendig, welche verstärkt in sozialen Institutionen verankert sind. Die britische Psychoanalytikerin Joan Riviere veröffentlichte 1929 den Aufsatz „Womanliness as a Masquerade” (dt. „Weiblichkeit als Maske”), in dem sie schrieb: Professionell erfolgreiche Frauen kleiden sich gerne ultraweiblich, um die Ängste ihrer männlichen Kollegen abzuwehren. Sie sah in dieser zur Schau getragenen Weiblichkeit ein Verhüllen oder Maskieren der männlichen Attribute der erfolgreichen Frauen. Die Selbstverstellung funktionierte, weil diese Kleidung als Zeichen natürlicher Weiblichkeit verstanden wurde. Wird diese These nun auf Künstlerinnen übertragen, die sich in einer von Männern dominierten Kunstwelt durchsetzen wollen, dann bedeutet dies, dass es keine inhärente natürliche Weiblichkeit gebe. Weibliche Identität sei eine soziale Konstruktion, welche durch stereotypische geschlechtsspezifische Kleidung, Gestik, Mimik und Körperhaltung immer wieder aufgegriffen wird. Dieser Gedanke, dass Weiblichkeit eine Verstellung, eine Verhüllung und Maske sei führt zu einer Dekonstruktion der traditionellen Selbstdarstellung. Dass eine Maske jederzeit austauschbar ist zeigt ein Selbstporträt von Petra Paul, in dem sie sich einen Bart aufklebte. Dieses Bild des Selbst, polar zwischen Femininität und Maskulinität angesiedelt, ist jederzeit austauschbar.  Der eigene Kunstkörper wird nicht nur als Maske der Weiblichkeit mit maskulinen Elementen, sondern auch als Maske der Identität der Künstlerin wiedergegeben. Das Selbst befindet sich hinter Masken, wenn es um den öffentlichen Blick geht. Frauen leben unter dem Druck, für andere etwas anderes darzustellen, als sie sind. Dadurch können sie leichter das traditionelle Verständnis, das die Frau dem Bild gleichsetzt unterlaufen, indem sie beispielsweise parodistisch in Erscheinung treten. Petra Paul ist in den Selbstporträts nicht das passive Objekt des fremden Blickes, da sie alles selbst inszeniert. Sie parodiert die heute gängigen Erwartungen an Weiblichkeit, indem sie beispielsweise maskuline Elemente einfließen läßt und macht somit sichtbar, dass Weiblichkeit eine Konstruktion ist. Mit diesem Thema setzt sich die Künstlerin in der Serie female masculinity auseinander - unter diesem Titel wird am 10. Jänner 2003 im neu eröffneten Frauenzentrum (1090 Wien, Währinger Straße 59/6, Eingang Prechtlgasse) eine Ausstellung mit Fotografien und Menstruationsblutbildern von Petra Paul zu sehen sein. Aspekte, die in der Schau im Frauencafé angedeutet sind, werden zu einem eigenen Ausstellungskonzept ausgearbeitet. 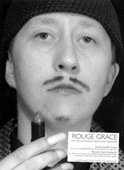 Destruktion der intakten Bildwelt
Der weibliche Körper wird als Ort weiblicher Authentizität gesehen – von der männlichen Ordnung unterdrückt – die Wiederaneignung des eigenen Körpers kann aber zurückgewonnen werden. Lucy Lippard schrieb, dass wenn Frauen ihren Körper gebrauchen, sie ihr Selbst verwenden. Die Beziehung der Menschen zu ihrem Abbild ist geprägt von dem ganzheitlich gesehenen Körper. Petra Paul reflektiert den weiblichen Bildstatus der (Selbst)Inszenierungen zwar mit, aber Ausschnitthaftigkeit, Beleuchtungseffekte, welche die Wiedererkennbarkeit abgebildeter Personen verringert, das Zerreißen von Fotos und die anagrammatische Neuanordnung einzelner Komponenten wirken gegen eine traditionelle ikonographische Tradition der Darstellung der Frau als Objekt des Begehrens, das für den männlichen Blick inszeniert ist. Eine lange Belichtungszeit, in der nur eine kurze Zeitspanne die dargestellte Person fotografisch aufgenommen wurde, lässt die Figur geisterhaft in einem Auflösungszustand erscheinen. Die Künstlerin kann dem Verschwinden des Selbst im Bild entgegenwirken, da sie die Umkehrung des einheitlichen, intakten Bildes inszeniert. Statt einer unversehrten Gestalt der Künstlerin bzw. der porträtierten Frauen sind Bruchstücke des Selbst erkennbar. Die Kamera rückt den Figuren meist nahe an den Leib, so dass sie nur im Ausschnitt erscheinen. Selten blicken die Protagonistinnen aus dem Bild, sie suggerieren entweder ein völliges In-Sich-Versunken-Sein (was aber eine passive, auf den voyeuristschen Blick ausgerichtete Position ist, aufgrund einer Nicht-Wahrnehmung des Blickes, der auf sie fällt), wenden sich von der Kamera ab, oder direkte Blicke aus dem Bild werden hinter Sonnenbrillen oder Kameras versteckt, wobei natürlich der Blick der Künstlerin durch die Kamera ein aktiver, für BetrachterInnen bedrohlicher ist. In einem Selbstporträt montierte die Künstlerin einen schwarzen Balken vor ihre Augen. In scheinbare Anonymität verfallen nimmt sie dadurch Bezug auf den Iris-Scan, da die Iris wie der Fingerabdruck individuell ist. Dafür zeichnete sie einen Barcode, der übersetzt Petra Paul heißt, auf ihr Hirn. Der Körper wurde somit selbst zu einem Bild, der wiederum – in Form einer Fotografie – verbildlicht wurde. Durch Verkleidung, mit der Kamera vor dem Gesicht wird die Wiedererkennbarkeit der Künstlerin gemindert. Der Blick durch die Kamera in den Spiegel, welcher die Blicke der Anderen repräsentiert, bringt das illusorische Element des dem Spiegelbild verdankter Identität zum Bewusstsein. Die Erfahrung der eigenen Fremdheit im Spiegelbild wird dadurch sichtbar und ergreift vom Körper der Künstlerin Besitz.  Aber auch Selbstporträts ohne Spiegel sind von der Spiegelerfahrung nicht zu trennen. Das blickende Ich ist zugleich auch das erblickte, die Fotografin ist Betrachtende und Betrachtete, die einen Teil des Körpers als Bild begreift. All diese Inszenierungen enthalten aber keine neuen Weiblichkeitsbilder, sondern zeigen ein reflexives Verhältnis der Künstlerin zum Bild der Frau. In den Werken wird die Sichtbarkeit des Selbst dargestellt – auch im Verschwinden – und die Kontrolle der Repräsentation, welche die Fähigkeit zum Darstellen selbst beinhaltet. Die Künstlerin ist dadurch nicht nur image, sondern auch gleichzeitig image-maker.
Petra M. Springer, Portraits as Images, in: [sic!] Forum für feministische GangArten, Nr. 43, Dezember 2002, Wien 2002, S. 15-16. |

